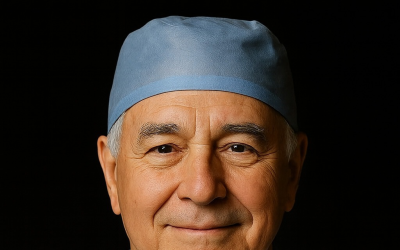Zwei Tage vor Weihnachten ignorierte ich alle Warnungen vor Fremden und nahm eine zitternde Mutter mit ihrem Baby auf. Ich glaubte, ich würde ihnen nur einen warmen Platz für die Nacht bieten – und ahnte nicht, dass dies unser aller Leben verändern würde.
Zwei Tage vor Weihnachten nahm ich eine Mutter mit ihrem Baby bei mir auf. Am Weihnachtsmorgen kam ein Paket mit meinem Namen darauf an – und alles änderte sich.
Ich bin 33 und ziehe meine beiden kleinen Mädchen alleine groß. Sie sind fünf und sieben Jahre alt und glauben mit absoluter Überzeugung an den Weihnachtsmann.
Mehr erfahren
Familienspiele
Sie kritzeln Briefe voller spiegelverkehrter S und schiefer Herzen. Sie diskutieren, welche Kekse er am liebsten mag. Sie nehmen das Ganze sehr ernst.
Ihr Vater ist vor drei Jahren weggegangen.
Nicht mit Streit oder Abschied – einfach ein allmähliches Verschwinden. Weniger Nachrichten. Verpasste Anrufe. Abgesagte Besuche. Bis ich eines Tages bemerkte, dass er seit Wochen nicht mehr nach den Mädchen gefragt hatte.
Jetzt sind wir nur noch wir selbst.
Ich arbeite in einem Krankenhaus.
Ich plane meine Einkäufe wie eine Mission mit hohem Einsatz.
Ich weiß, in welchem Geschäft die Milch am günstigsten ist, welches Frühstücksbrot im Angebot ist und wie man aus einer Packung Hackfleisch drei Abendessen zubereiten kann.
Ich habe gelernt, wie man verstopfte Abflüsse repariert, Sicherungen wieder einschaltet und unsere uralte Heizung wieder zum Laufen bringt.
Manche Tage fühle ich mich stark und leistungsfähig.
An anderen Tagen habe ich das Gefühl, wenn noch etwas kaputtgeht, sinke ich einfach auf den Küchenboden und bleibe dort liegen.
Unser einziges wirkliches Polster ist das Haus.
Es gehörte meinen Großeltern.
Es ist klein, laut und die Fassadenverkleidung hat schon bessere Jahrzehnte gesehen – aber es hat sich gelohnt.
Dass wir keine Hypothek haben, ist der Grund, warum wir noch über Wasser sind.
Zwei Nächte vor Weihnachten fuhr ich nach einer Spätschicht nach Hause.
Diese tiefe Erschöpfung hatte eingesetzt – die Art von Erschöpfung, bei der die Augen brennen und sich alles ein wenig unwirklich anfühlt.
Mehr erfahren
Familienspiele
Es war bereits dunkel.
Die Straßen glänzten unter einer dünnen Eisschicht, die harmlos aussah, sich aber alles andere als harmlos anfühlte.
Sanfte Weihnachtsmusik klang aus dem Radio, während mein Gehirn seine müde Checkliste durchging.
Geschenke einpacken.
Kleinigkeiten im Nikolausstiefel verstecken.
Nicht vergessen, den blöden Elfen umzustellen.
Meine Töchter waren bei meiner Mutter.
Sie hatten heiße Schokolade, Zuckerkekse und zu viele Weihnachtsfilme gesehen.
In meiner Vorstellung sahen ich sie schlafend in Flanellpyjamas, die Wangen rosig, die Münder noch leicht geöffnet vom Schlaf.
Warm. Sicher.
Ich verspürte eine Welle der Dankbarkeit – und dann den vertrauten Gedanken: Ich muss ja noch alles einpacken, wenn ich nach Hause komme.
Da habe ich sie gesehen.
Sie stand an einer Bushaltestelle, halb geschützt unter dem kleinen Plastikvordach.
Eine Frau, die ein Baby fest an ihre Brust drückt.
Sie lief nicht auf und ab.
Sie schaute nicht auf ihr Handy.
Sie stand einfach nur da. Völlig still.
Der Wind war gnadenlos – von der Sorte, die einem durch Mäntel und Knochen hindurchschneidet.
Das Baby war in eine dünne Decke gewickelt, die Wangen rot vor Kälte. Eine winzige Hand lugte hervor, die Finger steif und gekrümmt.
Mir schnürte es die Brust zu.
Ich fuhr an ihr vorbei.
Für vielleicht fünf Sekunden.
Da gingen in meinem Kopf gleichzeitig alle Warnsignale los.
Die ganzen Vorträge über Fremde.
Die ständigen Erinnerungen daran, dass ich jetzt Mutter bin – dass ich nicht leichtsinnig sein darf.
Und darunter, in einem ruhigeren Gedanken:
Was wäre, wenn ich das wäre?
Was wäre, wenn das mein Kind wäre?
Ich verlangsamte mein Tempo.
Angehalten.
Meine Hände zitterten, als ich das Beifahrerfenster herunterließ.
„Hey“, rief ich. „Ist alles in Ordnung?“
Sie zuckte zusammen und trat dann näher.
Aus der Nähe betrachtet, wirkte sie unbeschreiblich erschöpft – dunkle Augenringe, rissige Lippen, das Haar zu einem Dutt zusammengebunden, der längst aufgegeben hatte.
„Ich…“ Sie hielt inne und schluckte schwer. „Ich habe den letzten Bus verpasst.“
Sie umklammerte das Baby fester.
„Ich habe heute Abend nirgendwo hinzugehen.“
Sie weinte nicht.
Sie sagte es ruhig, wie jemand, der bereits all seine Energie darauf verwendet hatte, die Situation zu verarbeiten.
„Ist jemand in Ihrer Nähe?“, fragte ich. „Familie? Freunde?“
„Meine Schwester“, sagte sie. „Aber sie wohnt weit weg.“
Sie wandte verlegen den Blick ab.
„Mein Handy war leer. Ich dachte, es käme noch ein Bus. Ich hatte die Zeiten falsch eingeschätzt.“
Der Wind riss durch die Bushaltestelle.
Ich warf einen Blick auf die leere Straße, den glatten Bürgersteig, die geröteten Wangen des Babys.
Meine Töchter schliefen in warmen Betten im Haus meiner Mutter.
Dieses Kind war hier draußen in der Kälte.
Bevor meine Angst protestieren konnte, kamen die Worte aus meinem Mund:
„Okay. Komm rein. Du kannst heute Nacht bei mir übernachten.“
Ihre Augen flogen auf.
„Was? Nein – das kann ich nicht. Du kennst mich doch gar nicht.“
„Das stimmt“, sagte ich. „Aber ich weiß, dass es eiskalt ist und Sie ein Baby im Arm halten. Bitte. Steigen Sie ein.“
Sie zögerte einen Augenblick.
Dann öffnete sie die Tür und stieg ins Auto, das Baby immer noch fest im Arm, wie eine Rüstung.
Sobald ihn die warme Luft berührte, stieß er einen kleinen, müden Schrei aus.
„Wie heißt er?“, fragte ich, als ich vom Bordstein wegfuhr.
„Oliver“, sagte sie, und ihr Gesichtsausdruck wurde augenblicklich weicher. „Er ist zwei Monate alt.“
Sie rückte ihn sanft zurecht.
„Ich bin Laura“, fügte sie hinzu.
Fortsetzung auf der nächsten Seite:
Fortsetzung auf der nächsten Seite
Die vollständige Kochanleitung finden Sie auf der nächsten Seite oder durch Klicken auf die Schaltfläche „Öffnen“ (>). Vergessen Sie nicht, den Beitrag mit Ihren Freunden auf Facebook zu teilen.